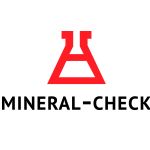Mikroplastik im Körper – Was wissen wir wirklich über die Auswirkungen auf den Menschen?
Mikroplastik – Partikel <5 mm – ist mittlerweile allgegenwärtig: in der Umwelt, in Lebensmitteln und in biologischen Proben des Menschen. Die Aufnahme durch den menschlichen Körper ist nachgewiesen, jedoch sind viele Fragen hinsichtlich der Auswirkungen weiterhin offen.
Definition und Expositionsquellen
Mikroplastik entsteht durch Fragmentierung größerer Kunststoffprodukte oder wird industriell als Primärmikroplastik erzeugt (z. B. in Kosmetika).
Relevante Aufnahmewege:
- Trinkwasser: Leitungs- und Flaschenwasser können Mikropartikel enthalten.
- Nahrung: Besonders belastet: Meeresfrüchte, Fisch, Salz, verarbeitete Produkte.
- Luft: Feine Partikel können inhaliert werden, insbesondere in urbanen Zonen.
- Hygieneprodukte: Zahnpasta und Peelings enthalten häufig mikroskopische Kunststoffe.
- Verpackungsmaterialien: Abrieb kann in Lebensmittel übergehen.
Schätzung der durchschnittlichen Aufnahme:
Ein Mensch nimmt durchschnittlich etwa 5 Gramm Mikroplastik pro Woche auf – das entspricht ungefähr der Masse einer Kreditkarte.
Potenzielle gesundheitliche Risiken
1 Nachweis im Organismus
- 2022: Erstmals Mikroplastik im menschlichen Blut nachgewiesen.
- Studien zeigen: Partikel zirkulieren im Blutkreislauf und können sich in Organen akkumulieren.
- Nanoplastik (<100 nm) kann Zellbarrieren durchdringen.
2 Endokrine Disruption
- Additive wie BPA gelten als hormonaktive Substanzen (endokrine Disruptoren).
- Potenzielle Effekte:
- Störungen der Fruchtbarkeit
- Schwächung des Immunsystems
- Erhöhtes Risiko hormonell bedingter Erkrankungen (z. B. Brustkrebs, Diabetes).
3 Entzündungsreaktionen & Zellschäden
- In-vitro-Versuche zeigen: Mikroplastik kann Entzündungen und zelluläre Schäden induzieren.
- Langfristig könnten chronische Erkrankungen begünstigt werden.
4 Einfluss auf die Darmflora
- Hypothese: Mikroplastik könnte das mikrobielle Gleichgewicht stören.
- Mögliche Folgeerscheinungen:
- Gastrointestinale Beschwerden
- Immunmodulation
- Chronische Darmerkrankungen
Potenzielle positive Aspekte (im kontrollierten Umfeld)
- Schnelle Ausscheidung: Ein Großteil der Partikel wird über den Stuhl ausgeschieden.
- Medizinische Anwendung: In der Forschung wird Mikro- und Nanoplastik als mögliches Trägersystem für zielgerichtete Medikamentenabgabe untersucht.
Hinweis: Diese positiven Eigenschaften gelten ausschließlich für kontrolliert synthetisierte Partikel in der Biomedizin, nicht für Umweltmikroplastik.
Präventions- und Reduktionsstrategien
Empfohlene Maßnahmen zur Minimierung der Aufnahme:
- Keine Erwärmung von Plastikverpackungen in der Mikrowelle.
- Einsatz hochwertiger Wasserfilter.
- Verzicht auf Produkte mit Mikroplastik (Kosmetika, Zahnpasta).
- Reduzierter Konsum belasteter Lebensmittel (v. a. Muscheln, Thunfisch).
- Verwendung von Glas, Edelstahl statt Kunststoffen im Alltag.
- Bevorzugung unverpackter Lebensmittel.
Was belegt ist:
- Mikroplastikpartikel wurden im Blut, in Organen und im Stuhl des Menschen nachgewiesen.
- Laborstudien zeigen Hinweise auf entzündliche Prozesse, hormonelle Beeinflussung und mögliche Effekte auf die Darmmikrobiota.
Was unklar bleibt:
- Ab welcher Dosis gesundheitliche Gefahren auftreten.
- Welche Mengen im Körper persistieren.
- Ob Langzeitrisiken wie Karzinogenität oder neurologische Effekte bestehen.
Weiterführende Forschungsfragen:
- Wie interagiert Mikroplastik mit anderen Schadstoffen im Körper?
- Gibt es populationsspezifische Unterschiede in der Anfälligkeit?
- Welche Rolle spielt die Partikelgröße (Nano vs. Mikro)?